Das große Ziel der Naturwissenschaften ist es, prinzipiell alles erklären zu können. Etwas erklären bedeutet in der Regel, es zurückzuführen auf etwas Einfacheres, das bereits erklärt ist, und es so in eine möglichst lückenlose Kette von Erklärungen einzubetten, die bis zu den elementarsten Wahrheiten hinunterreicht, die nicht weiter erklärt werden müssen oder können. Die komplexen Funktionen des Laptops, mit dem diese Rezension geschrieben wurde, sind erklärbar durch seine Konstruktion nach Prinzipien der Elektrotechnik und der Funktion seiner einzelnen Bauteile, die sich wiederum auf Eigenschaften der verwendeten Materialien und schließlich der Elementarteilchen zurückführen lassen. Diese Methode der Reduktion ist so erfolgreich und allgegenwärtig, dass sie sich kaum vom wissenschaftlichen Denken trennen lässt, und die Hoffnung, dass sich auf diese Weise im Prinzip einmal alles erklären ließe, wenn man nur lange genug forsche, ist so weit verbreitet, dass sie kaum Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen ist.
Natürlich macht das mächtige Prinzip auch vor uns selbst nicht halt. Unsere eigene Geisteswelt und das, was man einmal Seele genannt hat, soll auf neuronale Aktivitäten in unserem Gehirn zurückgeführt werden, das sich laut Evolutionstheorie aus den einfacheren Gehirnen unserer tierischen Vorgänger entwickelt hat, einer Ahnengalerie, die bis zum primitiven Einzeller zurückreicht. In dieser Deutung sind wir selbst also auch nur das Produkt elementarer Grundprinzipien und einer langen Kette von Zufällen. Während wir in früheren, religiösen Vorstellungen Krone und Zentrum der Schöpfung waren, sind wir dank des Reduktionsprinzips nur noch eher unbedeutende, zufällige Randerscheinung. Etwas mehr Sinn und Bedeutung würde man sich natürlich schon wünschen. Deshalb gerät jeder sofort unter Verdacht, einem religiös oder esoterisch motivierten Wunschdenken zu folgen, der die universelle Erklärungsmacht des Reduktionsprinzips trotz seiner Unumstrittenheit in den Naturwissenschaften anzuzweifeln wagt. Auf dieses dünne Eis begibt sich Thomas Nagel mit seinem Buch „Geist und Kosmos“, dessen deutsche Übersetzung im Jahr 2013 erschienen ist.
Dieses Buch ist nicht Nagels erster Angriff auf einen reduktionistischen Materialismus. Es lohnt sich, erst einmal über seinen wohl berühmtesten Text zu sprechen, den Aufsatz „What ist it like to be a bat?“ – „Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?“ aus dem Jahr 1974. Die Antwort auf die Frage im Titel dieses Textes lautet: Wir wissen es nicht, und können es niemals wissen, denn egal wie gut wir das Sonarsystem und das Gehirn der Fledermaus verstanden haben, wir werden uns keine Vorstellung davon machen können, wie die Welt aus der Perspektive einer Fledermaus aussieht. Unser räumliches Sehen ist so verschieden von der Art, wie die Fledermaus ihre Umgebung wahrnimmt, dass wir uns beim besten Willen nicht in sie hineinversetzen können. Nagels Schlussfolgerung aus diesem Gedankenexperiment ist aber: Selbst wenn wir es mit einem anderen Wesen zu tun hätten, in das wir uns im Prinzip hineinversetzen könnten, einen anderen Menschen also, dessen Wahrnehmungsapparat sich von unserem kaum unterscheidet, könnten wir trotzdem nicht herausfinden, wie es tatsächlich ist, Sinneseindrücke aus der Perspektive des anderen zu erleben. Wir können nicht herausfinden, wie genau es für den anderen ist, die Farbe Rot zu sehen oder eine heiße Herdplatte zu berühren. Auch wenn der andere die Farbe ebenfalls „Rot“ nennt und seine Hand von der Herdplatte zurückzieht, genau wie wir, ist längst nicht klar, wie genau Rot für ihn aussieht oder die Platte sich anfühlt. Wie im Fall der Fledermaus gilt auch hier, dass sich diese Fragen nicht dadurch beantworten lassen, Hirnaktivitäten und Sinnesorgane zu untersuchen, egal wie gut man diese einmal verstehen wird. Der Reduktionismus scheitert an diesen Fragen.
Wenn es also nicht möglich ist, diese Eindrücke mit einander zu vergleichen, die unsere eigene Perspektive auf die Welt ausmachen, und diese Aspekte daher nicht erforscht und kommuniziert werden können, dann liegen sie also außerhalb dessen, was Gegenstand der Naturwissenschaften ist. Sie fügen sich nicht in das gängige Reduktionsschema und fallen so aus dem materialistischen Weltbild heraus. Eigentlich ist es nicht einmal überraschend, dass gerade diese Aspekte, die unsere individuelle Perspektive ausmachen, sich nicht in das naturwissenschaftliche Bild eingliedern wollen, denn es ist ja gerade ein Grundprinzip der Naturwissenschaften, genau diese Perspektive auszuklammern. Eine Beobachtung gilt der Naturwissenschaft seit jeher nur dann als wahr, wenn sie von der Person und Perspektive des Beobachters unabhängig ist. Dass eine Wissenschaft, die nach dem Prinzip aufgebaut ist, die Beobachterperspektive vor die Tür zu schicken, auf Probleme stößt, wenn sie nach allem anderen nun doch auch diese Perspektive zu erklären versucht, ist nicht erstaunlich.
Aus dem eigenen Weltbild ausgebürgert
Ausgerechnet diese Perspektive ist es aber, die wir meinen, wenn wir „ich“ sagen. Es ist gewissermaßen das was unser Leben ausmacht, der innere Kern unseres Bewusstseins, der hier unerklärt bleibt. Wenn wir uns nicht selbst vollständig aus unserem eigenen Weltbild ausbürgern wollen, kann diese Erklärungslücke nur unbefriedigend sein. Die Lücke deutet darauf hin, dass das materialistische Weltbild auch nach allen Ergänzungen und Verfeinerungen, die die Naturwissenschaften noch hinzufügen werden, nicht die letzte Antwort sein kann. Nagels Aufsatz „What ist it like to be a bat?“ hat in den letzten Jahrzehnten sehr wesentlich zum Entstehen einer Denkrichtung in der Philosophie des Geistes beigetragen, in der eine ganze Reihe von Autoren dieses Problem inzwischen sehr ernst nehmen und die Aspekte unserer Erlebnisse, die offenbar nicht wissenschaftlich zugängig sind, unter dem Begriff der sogenannten Qualia zusammenfassen.
In „Geist und Kosmos“ geht Thomas Nagel nun zwei Schritte weiter. Zusätzlich zum Bewusstsein sieht Nagel auch in unserem abstrakten Verstand und unserer Fähigkeit, über moralische Werte zu sprechen, Eigenschaften, die nicht zufriedenstellend durch den gängigen reduktionistischen Materialismus erklärt werden. Diese Kritik gilt insbesondere dem Unfehlbarkeitsanspruch der Evolutionstheorie, wie er von Richard Dawkins und anderen populären Autoren propagiert wird. Nagel zweifelt nicht am Grundprinzip der Evolution, aber er weist auf Lücken hin, die er für zu gravierend hält, um nicht über fundamentale Ergänzungen und Alternativen nachzudenken. Insbesondere betont er, dass die Evolutionstheorie erstens keine plausible Erklärung für die Entstehung des Lebens biete, denn, dass ein komplexes System wie die DNA inklusive eines Mechanismus sie auszulesen und zu reproduzieren ad hoc aus Zufällen entstehe, sei unwahrscheinlich. Zweitens biete die Evolution keine zufriedenstellende Erklärung für das Entstehen von Bewusstsein, Vernunft und der Empfänglichkeit für moralische Werte.
Lücken der Evolutionstheorie
Ein wesentliches Argument ist hier jeweils, dass all das nicht unmittelbar mit der Überlebens- und Reproduktionsfähigkeit von Organismen verknüpft ist. Die Entdeckung logischer Prinzipien und der Mathematik und die Fähigkeit, abstrakte Werte zu erkennen, die über die Wahrung des eigenen Wohls hinausgehen und in manchen Fällen sogar dazu führen, gegen die eigenen Interessen zu handeln, erscheinen Nagel nicht ausreichend mit dem Prinzip des survival of the fittest begründbar. Sollte man eine Erklärung dieser Fähigkeiten durch die Evolutionstheorie akzeptieren, dann wären sie nichts weiter als zufällig entstandene und nicht weiter notwendige Nebeneffekte. Aus Nagels Sicht wäre das unbefriedigend, da sich diese Fähigkeiten auf die Logik und auf moralische Werte beziehen, die seiner Ansicht nach nicht nur unserer Fantasie entsprungen sind, sondern tatsächlich existieren. So wie das Evolutionsprinzip in der Lage ist, zu erklären, dass unsere Augen Licht in einem für uns relevanten Spektrum sehen, sollte es auch, wenn es eine umfassende Erklärung bieten will, unsere Empfänglichkeit für diese anderen, sehr wesentlichen realen Eigenschaften des Universums plausibel machen. Dass dies fehlschlägt hält Nagel für einen weit über den Bereich der Evolutionstheorie hinaus wirkenden Defekt, der das gesamte reduktionistisch-materialistische Weltbild in Frage stellt.
Diese weitreichenden Konsequenzen des Defekts werden in seiner Diskussion möglicher Alternativen deutlich. Über weite Teile des Buches legt Nagel hier in einer systematischen Spekulation dar, welche grundlegenden Eigenschaften eine Theorie zur Erklärung des menschlichen Geistes und seiner Entstehung im Einklang mit den naturwissenschaftlich bestätigten Fakten haben müsste. Eine der von Nagel präferierten Eigenschaften einer solchen über den gängigen Materialismus hinausgehenden Theorie würde geistige Eigenschaften als elementares Prinzip in der Natur einführen, lange vor der Entstehung des Lebens, von Beginn des Universums an. Der Gedanke geht in die Richtung eines neuen Elementarteilchens oder einer bisher unentdeckten Quantenzahl, in der die Möglichkeit der späteren Entstehung von Bewusstsein bereits vorgegeben ist. Ein anderer von Nagel ins Spiel gebrachter Aspekt möglicher neuer Theorien ist eine nicht-kreationistische Teleologie, nach der das Entstehen von Leben und Geist durch elementare Prinzipien der Naturgesetze von Anfang an angestrebt wird.
Das erwachende Universum
So schwierig es auch ist, sich solche Theorien realistisch vorzustellen, hätten sie doch den Vorteil, die zu erklärenden geistigen Fähigkeiten nicht als beliebiges Zufallsprodukt auftreten zu lassen. Nagel fasst diese möglichen Theorien mit dem Bild eines langsam erwachenden und sich selbst bewusst werdenden Universums zusammen. Das Universum bietet in seinen Grundprinzipien und Elementen die Möglichkeit zur Entstehung von Leben und Geist von Anfang an und steuert gezielt darauf hin, durch dieses Leben seine eigenen geistigen Prinzipien von Logik und Wert erkennen zu lassen. Es wäre eine Geschichte des Universums, die nicht nur von Zufällen sondern von einem Sinn angetrieben wäre.
An manchen Stellen des Buches darf man sich fragen, ob Nagel das Prinzip, dass der Geist und seine Fähigkeiten nicht nur ein zufälliges Abfallprodukt der Evolution sein dürfen, etwas zu wichtig nimmt und er damit einer Variante anthropozentrischen Denkens verfällt. Seine Spekulation über Alternativen zum etablierten naturwissenschaftlichen Weltbild ist aber, selbst wenn man seiner Kritik nicht ganz folgen will, ein spannender und gewagter Ausflug in Bereiche weit jenseits des wissenschaftlichen Mainstream. Es bleibt die Frage, ob Nagels Argumente nur eine Geschmacksfrage sind, was eine umfassende Theorie der Natur, die uns selbst beinhaltet, erklären können muss und ob seine an solche Theorien gesetzten Ansprüche zu hoch sind. Letztlich geht es um die Frage, wie ernst wir unsere eigene geistige Existenz eigentlich nehmen wollen. Nagel nimmt sie sehr ernst und gibt mit diesem Werk Ansätze vor, aus denen eine ganz neue Sichtweise entstehen könnte. „Geist und Kosmos“ kann als eine hoffnungsvolle Vorahnung auf eine künftige wissenschaftliche Revolution gelesen werden und spekuliert über die Zukunft eines verbesserten Weltbildes, in dem wir selbst wieder eine Rolle spielen. In jedem Fall ist das Buch ein lesenswerter Blick, weit über alle Tellerränder hinaus.
Geist und Kosmos auf Amazon
Ähnliche Beiträge:

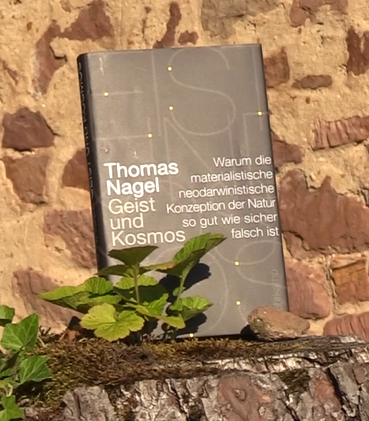
Das klingt ausgesprochen spannend!- Vielen Dank für die ausführliche Rezension.
LikeGefällt 1 Person
In Zeiten, in denen wir zu Weihnachten tafeln werden wie bei Grafens (mein ausgezogener Esstisch für drei Personen), werde ich schon froh sein, mehr Tellerränder als meinen eigenen zu sehen. Das vorgestellte Werk verspricht jedoch spannende, wenn auch etwas anstrengende Lektüre. – Was nun die Fledermaus betrifft, so denke ich mir einfach: Wäre ich eine Fledermaus, hätte ich weit größere Sorgen vielleicht irgendwann einmal inkontinent zu werden.
LikeGefällt 1 Person
Pingback: Der letzte Alleskönner | „Maker of Patterns“ von Freeman Dyson – Anton Weyrother
Pingback: Aufräumarbeiten im Diskurs | „Archäologie des Wissens“ von Michel Foucault – Anton Weyrothers Literaturbetrieb
Pingback: Existenzielle Wohngemeinschaften | „Sphären I, Blasen“ von Peter Sloterdijk – Anton Weyrothers Literaturbetrieb
Pingback: Kants vergessene Mitspieler | „Tiere wie wir“ von Christine M. Korsgaard – Anton Weyrothers Literaturbetrieb