Die Geschichte der Ideen und insbesondere der Wissenschaften wird uns oft als eine klar in Kapitel unterteilbare Chronologie präsentiert. Anscheinend gibt es immer wieder lange Epochen mit nur sehr langsamen Fortschritten oder sogar Stagnation, bis einem großen Denker ein Durchbruch gelingt und alles wieder in Bewegung gerät. Einzelne Werke eines Newton, Darwin, Freud oder Einstein können eine solche Epoche einläuten und neue Denkweisen, Schulen und Traditionen begründen, die sich dann eine Weile halten, bis das nächste Genie die nächste bahnbrechende Entdeckung macht und so weiter.
Michel Foucault stört sich an dieser Sichtweise und sein Buch „Archäologie des Wissens“ aus dem Jahr 1969 ist der Versuch, diese Form der Geschichtsschreibung durch einen grundlegend anderen Ansatz zu ersetzen. Was Foucault insbesondere stört, ist die Fixierung auf einzelne Personen und ihre Werke, aber auch auf wissenschaftliche Traditionen, Begriffe und von der Wissenschaft untersuchte Themen, die von den Historikern dazu benutzt werden, Epochen von einander abzugrenzen. Etwa das erste Drittel des Buches verbringt Foucault damit, diese Kategorien in Frage zu stellen und sie durch etwas anderes zu ersetzen, das er als „diskursive Formationen“ bezeichnet. Diese Formationen sind Zusammenhänge, Strukturen und Praktiken, die sich in einem bestimmten Gebiet herausbilden, ohne dass dies auf ein einzelnes Werk, eine Person, einen neuen Begriff oder Untersuchungsgegenstand zurückginge. Als Beispiel dienen unter anderem verschiedene Epochen in der Psychiatrie, die sich laut Foucault dadurch kennzeichnen lassen, dass sich etwa eine bestimmte Form der Institutionalisierung in der Rolle der Krankenhäuser und Ärzte herauskristallisierte, die es vorher so nicht gab, oder sich ein neuer Einfluss auf die Rechtsprechung etablierte, indem Geisteskrankheiten dort nun anders berücksichtigt wurden als vorher.
Diese etwas abstrakten Zusammenhänge hält Foucault für wichtiger, als zum Beispiel das Auftreten einer bestimmten Person oder eines neuen Begriffs. Die selbe Krankheit war vielleicht schon seit Jahrhunderten Gegenstand der Fachdiskussionen, und dass man ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt einen neuen Namen gegeben hat, ist für die Abgrenzung einer Epoche oder einer neuen Disziplin weniger relevant, als die neuen Praktiken, mit denen man ihr begegnet, und die über das rein medizinische hinausgehen. Es sind der große Kontext und die Querverbindungen zu allen Bereichen dessen, was Foucault den „Diskurs“ nennt, die ihn interessieren. Die Formationen, von denen er spricht, um Diskurbereiche zu charakterisieren, sind nicht mit wissenschaftlichen Disziplinen identisch, sondern gehen über diese hinaus und umhüllen sie gewissermaßen im Gesamtkontext.
Was ist eine Aussage?
Nachdem dieser Begriff der Formation trotzdem sehr vage bleibt, und der erste Teil des Buches insbesondere erklärt, nach welchen Merkmalen man die Geschichte des Denkens nicht strukturieren sollte, unternimmt Foucault im zweiten Abschnitt, wie es zunächst scheint, den Versuch, der bisherigen Denkweise etwas handfestes entgegenzusetzen. Er konzentriert sich hier auf den Begriff die „Aussage“ als ein grundlegendes Element des Diskurses und zeigt zunächst, dass es nicht ganz einfach ist, klar zu definieren, was Aussagen eigentlich sind. Eine Aussage ist insbesondere nicht identisch mit einem Satz, denn verschiedene Sätze oder auch einzelne Satzteile können dasselbe aussagen. Andererseits kann ein und derselbe Satz, wenn er von verschiedenen Personen, zu verschiedenen Zeiten oder in verschiedenen Zusammenhängen ausgesprochen wird, vollkommen verschiedene Aussagen vermitteln. Die Aussage ist daher auch nicht mit dem Sprechakt oder der Äußerung eines Satzes identisch, denn diese sind vollkommen mit dem Kontext verknüpft und können im Gegensatz zur Aussage nicht davon gelöst und wiederholt werden. Dieselbe Aussage kann nach hundert Jahren erneut auftreten, aber nicht derselbe Sprechakt. Die Kriterien, die eine Aussage charakterisieren, sind laut Foucault daher nicht die der Logik, des Wahrheitsgehalts, der Grammatik oder der Ausdrucksformen. Stattdessen ist es etwas, das Foucault als die „Aussagenfunktion“ bezeichnet, die auf komplexe Weise die Dinge, auf die sich die Aussage bezieht, mit dem allgemeinen Kontext verbindet.
In einem nächsten Schritt stellt Foucault einen Zusammenhang zwischen den drei wesentlichen Begriffen her, die er bis hierhin eingeführt hat: Aussage, Formation und Diskurs. Die diskursiven Formationen, die bisher nicht wirklich greifbar erschienen, weil sie keine Einheiten sein sollen, die auf die übliche Weise durch die Nutzung von Begriffen, die Wirkung bestimmter Personen und Schriften oder gemeinsame Themen von einander abgrenzbar wären, stellen sich nun als das heraus, was auf der Ebene der Aussagen eine Einheit bildet. Es handelt sich um Gruppen von Aussagen. Die Aussagen gehören zur diskursiven Formation wie die Sätze zu einem Text und spielen darin entsprechend unterschiedliche Rollen. Ein Diskurs ist dann die Menge aller Aussagen, die zur selben diskursiven Formation gehören.
Diskurse ausgraben
Die Technik, mit der diese Diskurse untersucht werden sollten, nennt Foucault nun die „Archäologie des Wissens“. Diese Namensgebung drückt aus, dass es in seiner Methode um eine Freilegung der Diskurse geht, die nie ganz vollständig möglich ist und sich auf die Diskurse der Vergangenheit beziehen muss, weil die Formationen nur aus der zeitlichen Distanz überblickt werden können. Foucaults Archäologie will die Diskurse hervortreten lassen, so wie sie waren, und das Geflecht ihrer Aussagen untersuchen, aber nicht im üblichen Sinne interpretieren. Hier grenzt Foucault sich insbesondere davon ab, wie in der Ideengeschichte bisher mit inneren Widersprüchen und Irrtümern der Disziplinen umgegangen wurde. Die anfangs schon zitierte Darstellungsweise, nach der sich im lauf einer Epoche die kleinen Geister in ihren Sackgassen verirren, bis das große Genie erscheint und alle Widersprüche auflöst, wird durch eine kühlere, nicht voreilig wertende Sichtweise ersetzt, in der widersprüchliche Aussagen nicht nur im Hinblick auf die Beseitigung des Konflikts betrachtet werden. Der Irrtum ist hier nicht nur die lästige Vorstufe einer neuen Wahrheit. Alle Aussagen werden in der archäologischen Geschichtsschreibung gleichermaßen ernst genommen.
Es geht hier darum den Reflex zur Vereinfachung und zur Zusammenfassung zu großen Epochen und Strömungen zu unterdrücken und stattdessen die Vielfallt der Diskurse in ihrer Gesamtheit und auch Widersprüchlichkeit zu betrachten. Die Geschichte des Denkens soll in dieser archäologischen Methode nicht eine Erzählung sein, die auf ein großes Ziel zuläuft, auf die Auflösung aller Widersprüche, und von den großen Helden des Denkens handelt, die die Mauern des Stillstands mit ihren Entdeckungen durchbrechen, sondern sie ist ein komplexer Prozess, in dem die mit einander verflochtenen Aussagen die Hauptrolle spielen. Die Entwicklung der Wissensgebiete findet in dieser Sichtweise nicht mehr in großen Sprüngen statt. Das Aussagenfeld ist ständig in Bewegung und seine Brüche und Trennlinien sind viel feiner und subtiler, als es die alte Erzählweise von den großen Epochen uns weismachen wollte.
So in etwa charakterisiert Foucault selbst jedenfalls seine Methode, die eine bessere Alternative zur bisherigen Ideengeschichte darstellen soll. Wie man diese Techniken nun konkret anwendet und ob sie tatsächlich das bessere Bild von den Diskursen und insbesondere den Wissenschaften ergibt, ist natürlich erst einmal unklar. Mit „Archäologie des Wissens“ will Foucault zwar offenbar den Grundstein zu einer neuen Form der geisteswissenschaftlichen Geschichtsschreibung legen, aber ihm ist selbst, wie sich am Ende des Buches zeigt, sehr wohl bewusst, dass dieses hoch abstrakte und theoretische Werk nicht gerade eine hands-on-Anleitung ist, mit der seine Nachahmer sofort ans Werk gehen werden. Davon abgesehen erkennt Foucault auch die Widerstände, die seine Methode erst einmal überwinden müsste, um sich zu etablieren. Das letzte Kapitel des Buches ist als ein Dialog zwischen Foucault und einem imaginären Kritiker geschrieben, der sich weigert, die archäologische Sichtweise anzunehmen.
Anwendbarkeit der neuen Methode
Foucault glaubt nämlich, dass seine archäologische Methode ein weiterer Schritt in der Geschichte des Denkens wäre, mit dem das Subjekt und sein Bewusstsein oder sogar seine transzendente Bedeutung degradieren würde, und dass es schon aus diesem Grund harten Gegenwind geben müsse. Das Subjekt und seine Ziele spielen in dieser nüchternen Betrachtung der Diskurse nicht mehr die wichtige Rolle, die manche sich unbewusst für sich selbst und das eigene Werk wünschen. Das Denken wird zu einem mehr oder weniger entpersonalisierten Aussagenfeld und die Träger des Denkens, die Sprecher und Schreiber der Äußerungen, sind austauschbar geworden.
Stellenweise scheint es so, als ginge es Foucault mit diesem Werk insbesondere darum, das althergebrachte zu beseitigen, ohne es durch eine praktikable Alternative zu ersetzen. Es gibt aber doch auch konkrete Ergebnisse seines vorgeschlagenen Methodenwechsels. Zum Beispiel kommt er zu einer Klassifizierung von Entwicklungsstufen, die vorwissenschaftliche Diskurse durchschreiten, während sie sich zur ausgereiften Wissenschaft entwickeln. Er spricht hier von den Schwellen der Positivität, der Epistemologisierung, der Wissenschaftlichkeit und schließlich der Formalisierung, die von den Fachrichtungen normalerweise in gewissen zeitlichen Abständen überschritten werden. Eine Ausnahme unter den Wissenschaften ist in dieser Hinsicht die Mathematik, die sämtliche Schwellen im selben Schritt durchbrochen hat. Einige andere Diskurse wie etwa die Psychiatrie, die Theorie der Reichtümer und die Grammatik hat Foucault in anderen Werken in vorwissenschaftlichen Stadien untersucht und seine Methode anhand dieser Fälle entwickelt. „Archäologie des Wissens“ ist insofern eine Zusammenfassung und selbst eine Formalisierung dieser Werkzeuge.
Es ist ein sehr abstraktes Buch, das einen lange im Unklaren lässt, worum es eigentlich geht. Die Strukturen, die Foucault hier allgemein in Diskursen auszumachen versucht, sind kaum greifbar. Dass Foucault sich bei ihrer Beschreibung intensiv bei Begriffen der Mathematik und insbesondere der Geometrie bedient, indem er ständig von Ebenen, Oberflächen, konzentrischen Kreisen, Volumen, Distanzen und Vektoren spricht, leistet nur scheinbar eine Veranschaulichung in einem vollkommen abstrakten Raum und ist eher ein Symptom für die fehlende Greifbarkeit. Foucaults Schreibstil, insbesondere die Angewohnheit, seinen Beispielen und Nebenbemerkungen keine eigenen Sätze zu gönnen, sondern sie als verwirrend lange Einschübe in Klammern zu setzen und mitten in die eigentliche Aussage dazwischen zu mogeln, trägt nicht zur leichteren Lesbarkeit des Buches bei. Man hat vielleicht ungefähr in der Mitte der dreihundert Seiten eine erste Chance zu erkennen, wo die ganze Argumentation hinläuft und was überhaupt Gegenstand der Untersuchung ist. Dann allerdings wird es gegen Ende interessant wenn Foucault seine mühsam konstruierten Begriffe mit einander verbindet.
„Archäologie des Wissens“ ist insgesamt der spannende Versuch, das Denken über Wissenschaften, ihre Entwicklung und das ganze Feld um sie herum grundlegend umzukrempeln. Selbst wenn es nicht gelingen mag, Foucault zu folgen und sich von den alten Kategorien und Erzählweisen vollständig zu trennen, so werden diese immerhin ernsthaft in Frage gestellt und die Wissenschaftsgeschichte erscheint aus einer neuen Perspektive.
Archäologie des Wissens auf Amazon
Ähnliche Beiträge:


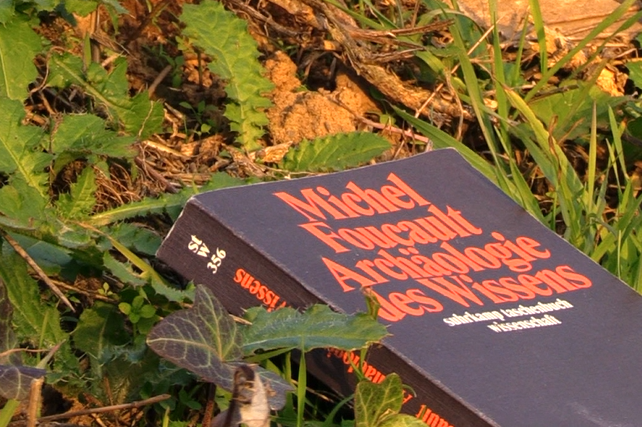
Pingback: Existenzielle Wohngemeinschaften | „Sphären I, Blasen“ von Peter Sloterdijk – Anton Weyrothers Literaturbetrieb
Pingback: Kants vergessene Mitspieler | „Tiere wie wir“ von Christine M. Korsgaard – Anton Weyrothers Literaturbetrieb