Das ambitionierte Projekt, das Ludwig Wittgenstein mit seinem berühmten „Tractatus logico-philosophicus“ aus dem Jahr 1921 verfolgt, ist die Entwicklung einer Sprache, die für die Beschreibung der Welt perfekt geeignet ist, weil sie keine Missverständnisse mehr zulässt. Wittgenstein war fest davon überzeugt, dass es sich bei den scheinbar unlösbaren großen philosophischen Problemen, einfach um sprachliche Missverständnisse handelte, die daraus entstanden, dass die Philosophen zur Formulierung ihrer Probleme im Wesentlichen die herkömmliche Alltagssprache benutzten, mit all ihren Zweideutigkeiten und sonstigen Fallstricken. In eine klare, unmissverständliche Sprache übersetzt würden sich diese philosophischen Rätsel sofort selbst auflösen, glaubte Wittgenstein.
Im Vorwort betont er ausdrücklich, dass er Ideen des Buches dem Einfluss Gottlob Freges und Bertrand Russels verdankt. Frege war ein deutscher Mathematiker und galt als der wichtigste Logiker seit Aristoteles. Mit seiner Ende des neunzehnten Jahrhunderts entwickelten Begriffsschrift stellte er die Disziplin der Logik auf sichere Beine und lieferte damit eine wichtige Grundlage der modernen Mathematik. Wittgenstein griff die von Frege entwickelte, abstrakte Sprache der Logik als Prototyp auf, um auf dieser Grundlage eine den Gesetzen der Logik streng gehorchende Sprache der Philosophie aufzubauen. Die Sätze dieser hypothetischen Sprache sind strukturell so aufgebaut wie Freges Logik und lassen sich in deren symbolische Kurzschreibweise übertragen. Der „Tractatus“ beschäftigt sich über weite Strecken damit, wie Freges Logik funktioniert und wie eine Sprache aussehen muss, die nach diesem Modell aufgebaut ist.
Die Sätze in Wittgensteins Sprache sollen je etwas über die Welt oder einen Teil von ihr aussagen, also beschreibende Sätze sein. Mit diesem Zweck ist eine gewisse Beschränktheit der Sprache verbunden, die zwar von Wittgenstein beabsichtigt ist, aber über deren Ausmaß er sich vielleicht erst in späteren Werken wirklich klar wurde. Das Entscheidende ist die strenge logische Verknüpfung zwischen den Sätzen der Sprache. Als Aussagen über die Wirklichkeit können die Sätze je entweder wahr oder falsch sein, und ob sie das eine oder das andere sind, hängt mittels der Logik von einzelnen Sachverhalten ab, die sich ebenfalls durch Sätze ausdrücken lassen. Zum Beispiel ist der Satz „Anand und Kasparov waren Schachweltmeister“ ein wahrer Satz, falls die beiden kürzeren Sätze „Anand war Schachweltmeister“ und „Kasparov war Schachweltmeister“ beide wahr sind. Damit diese Sätze wahr sein können, sollte man außerdem voraussetzen, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt Personen gegeben hat, die Anand und Kasparov heißen, und auch das lässt sich in separaten Sätzen ausdrücken. Unter diesen zusammenhängenden Sätzen gibt es laut Wittgenstein nun auf einer untersten Ebene einfachste Sätze, die sogenannten Elementarsätze, die jeweils nur einen Sachverhalt beschreiben und nicht weiter von anderen Sätzen abhängen. Der Wahrheitsgehalt aller Sätze, die sich in dieser Sprache formulieren lassen, hängt dann letztlich nur von den Elementarsätzen und deren Wahrheitsgehalt ab.
Die Elementarsätze sind unter einander logisch unabhängig. Im mathematischen Sinne kann man sie also als Basis der Sprache auffassen. Die Menge der durch sie gegebenen Möglichkeiten, die Wittgenstein als den Logischen Raum bezeichnet, enthält eine Beschreibung unserer Welt, aber prinzipiell auch anderer möglicher Welten. Zum Beispiel können wir uns eine Welt vorstellen, in der es zwar einen Schachweltmeister Anand gibt, aber Kasparov nicht existiert, und wieder eine andere, in der zwar der Satz „Kasparov existiert“ wahr ist, aber „Kasparov war Schachweltmeister“ falsch ist, und so weiter. Als ein wesentliches Ergebnis des „Tractatus“ leitet Wittgenstein eine allgemeinste Form her, in der jeder Satz seiner Sprache in logischer Abhängigkeit von den Elementarsätzen formuliert werden kann.
Sprache als Modell der Welt
So weit wäre der „Tractatus“ also ein technisches Buch über Logik und Sprache. Seine besondere Bedeutung als philosophisches Werk ergibt sich allerdings aus der engen Verbindung, die Wittgenstein zwischen der Welt und der sie beschreibenden Sprache geknüpft sieht. Wenn die Sprache in ihrer Struktur den Gesetzen der Logik folgt, nach denen auch die Welt strukturiert ist, dann ist die Sprache gewissermaßen ein Abbild der Welt. Das ist besonders dort interessant, wo diese auf der Logik basierende, deskriptive Sprache an Grenzen stößt, denn in einem gewissen subjektiven Sinne hört dort für Wittgenstein die beschreibbare Welt einfach auf. „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“, schreibt er an einer Stelle.
Die Art wie Wittgenstein mit diesen Grenzbereichen umgeht lässt sich mit dem im Vorwort erwähnten englischen Philosophen und Mathematiker Bertrand Russell in Verbindung bringen, mit dem Wittgenstein befreundet war. Russell ist im Zusammenhang der Logik besonders für eine paradoxe Konstruktion bekannt, nämlich die Menge, die alle Mengen enthält, die sich nicht selbst enthalten. Das hört sich in der Sprache der Mathematik nach einer sinnvollen Definition an, aber diese Menge kann es nicht geben. Wenn man davon ausgeht, dass die Menge sich selbst enthält, soll sie sich laut Definition gerade nicht enthalten, und wenn man umgekehrt davon ausgeht, dass sie sich eben nicht enthält, würde aus der Definition folgen, dass sie sich selbst enthalten darf. Als Veranschaulichung dieses Problems hat Russell den Barbier erfunden, der alle Männer rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Wenn man sich fragt, ob dieser Barbier sich selbst rasiert, gerät man in genau denselben unauflösbaren Widerspruch. Russell hatte Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts bereits Frege darauf hingewiesen, dass solche Widersprüche zunächst auch in dessen Logik möglich waren. Später haben Russell und andere dann dafür gesorgt, dass solche Pannen zumindest in der Mathematik nicht mehr passieren können. Mengen sollen sich jetzt nicht mehr so einfach selbst enthalten können. Die Menge und ihre Elemente wurden klarer von einander getrennt und auf verschiedene Stufen gestellt, damit Selbstbezüglichkeit keinen logischen Unsinn mehr erzeugen kann.
In seiner der Struktur der Logik folgenden Sprache muss nun auch Wittgenstein das Problem der Selbstbezüglichkeit vermeiden und er hat damit insbesondere an zwei entscheidenden Stellen zu tun, wie der Philosoph Holm Tetens in seinem 2009 als Reclam-Heft erschienenen Kommentar zum „Tractatus“ ausführlich erklärt. Wenn man es nicht ausdrücklich verbietet, ist Sprache nämlich gewissermaßen eine solche Menge, die sich selbst enthält. Da sie die gesamte Welt beschreiben soll, beschreibt sie eben auch sich selbst, weil sie ja Teil der Welt ist. Man kann zu jedem Satz also einen anderen Satz bilden, der den ersten Satz zitiert, zum Beispiel um ihn zu erläutern, und dann einen weiteren Satz, der auch diesen Satz aufgreift, und so weiter. Je weiter man diese Verschachtelung fortsetzt, desto weniger Sinn ergeben diese Meta-Sätze. Wittgenstein behauptet, dass es nicht nötig oder sogar unsinnig ist, Sätze über Sätze zu bilden, zumindest weil man ihren Bezug zu den Sachverhalten, die sie darstellen, dadurch nicht weiter erklären kann. Die Verbindung zwischen Welt und Sprache kann seiner Ansicht nach nicht in sinnvollen Sätzen ausgedrückt werden, sondern ergibt sich aus der Struktur der Sprache selbst. Wittgenstein ist sich allerdings bewusst, dass sein „Tractatus“ eigentlich selbst aus solchen von der Sprache handelnden Meta-Sätzen besteht, die er für unsinnig erklärt. Am Ende des Buches schreibt er deshalb:
Meine Sätze erläutern dadurch, daß sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie hinausgestiegen ist. (Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.)
Er muß diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig.
Satz 6.54
Über das Denken denken
Außerdem ist die Sprache, so wie Wittgenstein sie versteht, nicht nur Abbild der Welt, sondern auch des Denkens. „Der Gedanke ist der sinnvolle Satz“ heißt es an einer Stelle. Hierdurch trifft Wittgenstein noch an einem weiteren Punkt auf das Problem der Selbstbezüglichkeit, nämlich wenn es um das denkende Subjekt geht. Wenn ich versuche, jetzt in diesem Moment an mein eigenes Denken zu denken, dann denke ich vielleicht an den Gedanken, den ich gerade gedacht habe, und damit ist ein neuer Gedanke entstanden, an den ich wiederum denken müsste, und so weiter. Ich kann mir selbst nicht innerlich beim Denken zusehen, ohne in eine unendliche und eigentlich vollkommen sinnlose Schleife zu geraten. Aus diesem Grund bezeichnet Wittgenstein das Subjekt als eine Grenze der Welt. Es kann über die gesamte Welt sinnvoll nachdenken und sprechen, aber wenn es dabei auch sich selbst einbeziehen will, scheitert es. Wieder im Sinne der Mathematik gesprochen kann man sich die Welt also als eine offene Menge vorstellen, die zwar keinen klar definierten Rand besitzt, aber eine Schranke in Gestalt des Subjekts. In endlosen Denkschleifen nähert man sich dieser Schranke beliebig an, erreicht sie damit aber nie.
Das alles erinnert stark an das von Johann Gottlieb Fichte untersuchte Problem der Selbsterkenntnis, so wie es vor ein paar Jahren in Dieter Henrichs Buch „Dies ich, das viel besagt“ ausführlich zusammengefasst wurde. Auf dieses Buch will ich in einer der nächsten Episoden zurückkommen. Fichte hatte jedenfalls erkannt, dass eine klare Subjekt-Objekt-Beziehung, mit der wir die Welt beobachten, dann zusammenbricht, wenn wir uns selbst betrachten. Subjekt und Objekt des Denkens lassen sich dann nicht mehr auseinanderhalten und das wird zu einem scheinbar unüberwindlichen Problem, wenn man das Phänomen der Selbsterkenntnis wirklich verstehen will. Es ist bezeichnend, dass Wittgenstein im „Tractatus“ auf genau dieses fundamentale Problem stößt und wegen ihm sogar das Subjekt an den Rand der Welt verbannen muss. Es war ja sein erklärtes Ziel, mit seiner Sprache alle fundamentalen Probleme der Philosophie als Missverständnisse zu entlarven und zu ihrer sofortigen Auflösung zu bringen. Fichtes Problem der Selbsterkenntnis scheint eine so harte Nuss zu sein, dass Wittgenstein es bereits von vornherein in seiner Konstruktion von Sprache und Welt umgehen und als Randerscheinung wegdefinieren muss. Von einer Auflösung des Problems kann also keine Rede sein.
Die Welt ist für Wittgenstein im Wesentlichen das, was von den Naturwissenschaften untersucht und durch seine Logik-Sprache exakt abgebildet werden kann. Es kann deshalb leicht passieren, dass man den gesamten „Tractatus“ missversteht, wenn man diese Welt mit allem gleichsetzt, was existiert. Wittgenstein wäre dann ein radikaler Materialist ohne Sinn für Transzendenz, der nicht an moralische Werte glaubt, denn diese erklärt er als nicht zur Welt zugehörig. „Es ist klar, daß sich die Ethik nicht aussprechen läßt“, heißt es an einer Stelle, womit nach allem vorher gesagten wiederum klar ist, dass sie nicht Teil der Welt ist, denn die ist mit dem Sagbaren ja identisch. Für Wittgenstein hat die Welt aber nicht nur Grenzen, sondern, wie er am Ende des Buches andeutet, glaubt er auch an etwas, jenseits dieser Grenzen.
Worüber wir schweigen müssen
Der berühmte letzte Satz des „Tractatus“ lautet: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“ Gemeint ist damit, wovon man nicht sinnvoll innerhalb der Logik-Sprache sprechen kann, also was innerhalb der Welt liegt. Aber es ist auffällig, dass dieser Satz nicht lautet „Wovon man nicht sprechen kann, das gibt es auch nicht.“ Wittgenstein traut seiner Sprache einiges zu, aber er behauptet nicht von ihr, dass sie alles existente abdeckt. Im Gegenteil. Dass außerhalb der durch die Sprache beschreibbaren Welt noch etwas anderes existiert, betont Wittgenstein ausdrücklich, wenn er kurz vor dem Ende des Buches schreibt:
Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische.
Satz 6.522
Nach der Interpretation von Holm Tetens ist dieses andere, über das wir schweigen müssen, die eigentliche Essenz des Tractatus, und es handelt sich hierbei um das Ethische. Dass man über über ethische Werte nicht sinnvoll sprechen kann ist nach Tetens‘ Deutung für Wittgenstein nicht ein Defekt sondern das charakteristische Merkmal der Ethik. Was gut und böse ist, ergibt sich für ihn nicht aus Argumentationen über Tatsachen, sondern es ist jedem Menschen unmittelbar klar. Es gibt darüber grundsätzlich keinen Gesprächsbedarf.
Tetens beruft sich in dieser Interpretation auf einen dritten und im Vorwort nicht erwähnten Einfluss, unter dem Wittgenstein seiner Ansicht nach stand, nämlich den Einfluss Tolstois. Tetens gibt in seinem Kommentar eine Erzählung Tolstois wieder, die zu Wittgensteins Lieblingstexten gehört haben soll. Hier begeben sich zwei alte Männer auf eine Pilgerreise nach Jerusalem. Unterwegs übernachtet einer von ihnen bei einer verarmten und von Krankheiten heimgesuchten Bauernfamilie und beschließt, seine Reise zu unterbrechen, um der Familie zu helfen. Er unterstützt die Familie mit seinem gesamten Reisegeld und muss deshalb wieder nach Hause zurückkehren. Als sein Freund später aus Jerusalem zurückkehrt, kommt er auch bei dieser Familie vorbei und erfährt, dass der andere diesen Leuten geholfen hat. Als sich die beiden Männer zu Hause wieder treffen, spricht dieser aber selbst nicht über seine guten Taten. Was er für die Familie getan hat ist, wie es dort heißt, eine Sache zwischen ihm und Gott und muss nicht in Worte gefasst werden. Hier sieht Tetens die Parallele zum Tractatus, der das Moralische ebenfalls unausgesprochen lassen will.
Wittgenstein verbannt das Mystische und das Ethische also außerhalb der durch die Sprache beschreibbaren Welt, aber er leugnet es nicht und er lässt dort draußen, wenn man ihm Tolstois Sichtweise zuschreiben will, sogar Raum für die Existenz Gottes. Tetens betont, dass Wittgenstein in späteren Werken die Behauptung kritisierte, die Naturwissenschaften könnten alles erklären, und er sieht diese Kritik indirekt auch im „Tractatus“. Den Naturwissenschaften und der Sprache der Logik wird hier die Beschreibung der Welt als Aufgabe zugewiesen, aber dadurch, dass er dieses Spielfeld so klar und eng absteckt, wird deutlich, dass das Wesentliche außerhalb liegen muss. Überraschenderweise lässt sich in diesem Buch mit seinen trockenen, streng durchnummerierten Sätzen und logischen Formeln also ein Text über das unaussprechliche Transzendente erkennen. Tetens zitiert Wittgenstein hierzu mit dem an anderer Stelle geschriebenen Satz: „Ich bin zwar kein religiöser Mensch, aber ich kann nicht anders: ich sehe jedes Problem von einem religiösen Standpunkt.“
Programmierbare Philosophen
Ich persönlich musste beim Lesen des „Tractatus“ immer wieder an die Informatik denken, die es beim Erscheinen des Buches noch nicht gab. Im Computer ist ja genau wie es Wittgenstein vorschwebte die Welt, oder zumindest ein Teil von ihr, mit Hilfe einer streng den Gesetzen der Logik folgenden Sprache abgebildet, und gewisse Probleme werden dadurch im wahrsten Sinne des Wortes automatisch gelöst. Wittgensteins Denkweise zeigt, dass die Zeit für diese Erfindung Anfang der Zwanziger Jahre schon reif war und es ist einleuchtend, dass die Väter der neuen Technologie durch Wittgenstein inspiriert waren. Zum Beispiel ist bekannt, dass Alan Turing später in Cambridge in Vorlesungen von Wittgenstein saß und mit ihm diskutierte.
Über die Philosophie schreibt Wittgenstein im „Tractatus“:
Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die: Nichts zu sagen, als was sich sagen läßt, also Sätze der Naturwissenschaft – also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat -, und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen, daß er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. […]
Satz 6.53
Was Wittgenstein hier beschreibt ist genau die Rolle des Compilers einer Programmiersprache, der den eingegebenen Code eines Programmierers überprüft und eine Fehlermeldung zurückgibt, wenn eine der verwendeten Variablen nicht deklariert wurde. Zumindest nach seiner damaligen Denkweise, die sich später ändern sollte, wäre der Computer in Wittgensteins Augen der perfekte Philosoph gewesen. Der 1951 verstorbene Wittgenstein erlebte diese Erfindung zwar noch, wird ihre Bedeutung und unsere heutigen Möglichkeiten, auf Logiksprachen basierende Modelle der Welt zu erschaffen, wahrscheinlich nicht erahnt haben.
„Tractatus logico-philosophicus“ ist insgesamt also weit mehr als das trockene Logik-Buch, als das es anfangs erscheinen mag. Das kurze Buch ist ein dichter, tiefer Text über die Welt als Ganzes und sogar über das, was sie übersteigen mag. Es ist eine Vision der kommenden Automatisierung des Denkens über das, was sich aussprechen und heute in Programmiersprachen abbilden lässt. Und weil es über das, was sich nicht sagen lässt, eben doch nicht ganz schweigt, ist es auch eine Andeutung von Ethik und Mystik.
Tractatus logico-philosophicus auf Amazon
Ähnliche Beiträge:
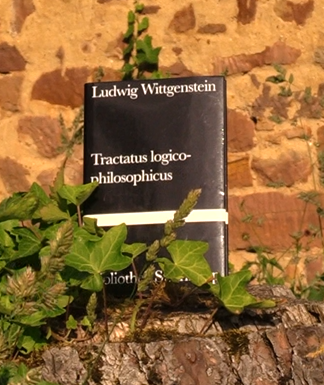
Absolut lesenswerter Beitrag;)
LikeGefällt 1 Person
An diese Stelle nur eine kurze transzendente Ergänzung von der Wittgenstein-Kennerin Ingeborg Bachmann:
Böhmen liegt am Meer
Sind hierorts Häuser grün, tret ich noch in ein Haus.
Sind hier die Brücken heil, geh ich auf gutem Grund.
Ist Liebesmüh in alle Zeit verloren, verlier ich sie hier gern.
Bin ich’s nicht, ist es einer, der ist so gut wie ich.
Grenzt hier ein Wort an mich, so laß ich’s grenzen.
Liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder.
Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land.
…
LikeGefällt 1 Person
Vgl. auch https://www.worldcat.org/de/title/568211760
LikeLike