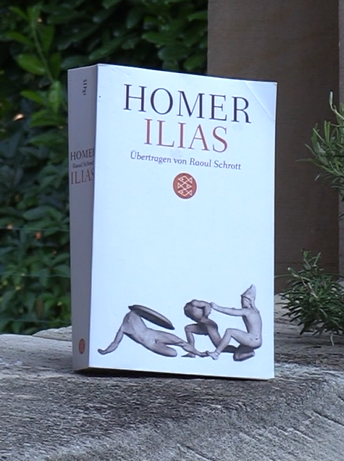Homers Ilias ist einer der bedeutendsten Klassiker der europäischen Literaturgeschichte, und dabei ist es nur der Mittelteil einer Chronologie des Trojanischen Krieges, die ursprünglich aus drei Texten unterschiedlicher Autoren bestand. Der erste und der letzte Teil dieser monumentalen Trilogie sind verschollen, nur ihre Inhaltsverzeichnisse sind überliefert, und so bleibt die Ilias, die eigentlich nur ein paar Tage dieser mehr als zehn Jahre dauernden Handlung schildert, eine Momentaufnahme aus der sagenhaften Mutter aller Kriege.
Im ersten Text der Trilogie, der „Kypria“, werden die Ursachen und Anfänge des Krieges erzählt, auf die in der Ilias immer wieder Bezug genommen wird. Homer geht davon aus, dass wir die Handlung dieses der Legende nach möglicherweise von seinem Schwiegersohn Stasinos geschriebenen ersten Teils bereits kennen, bevor wir die Ilias aufschlagen. Die Kypria beginnt damit, dass die Erde sich bei Zeus beklagt, weil zu viele Menschen auf ihr herumlaufen, denen es in letzter Zeit außerdem an Gottesfurcht fehlt. Zeus setzt, um die Zahl der Menschen zu dezimieren, eine komplexe Handlungskette in Gang, die zum trojanischen Krieg führen wird.
Zunächst bringt er die Göttin Thetis dazu, den sterblichen Peleus zu heiraten. Aus dieser Ehe geht später als ihr Sohn der Held Achilles hervor, die zentrale Figur der Ilias und des gesamten Krieges. Noch auf der Hochzeit streiten sich die Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite um den berühmten Zankapfel, den die eigentlich nicht zum Fest eingeladene Göttin des Streits unter sie geworfen hat. Zeus überlässt es Alexandros, einem manchmal auch Paris genannten Prinzen von Troja, diesen Streit zu schlichten und den Apfel der schönsten Göttin zu übergeben. Alexandros entscheidet sich für Aphrodite, weil diese ihm eine gewisse Helena als Frau verspricht.
Helena ist eine schöne Tochter des Zeus, die eigentlich schon mit einem Griechen namens Menelaos verheiratet ist, aber das stört den Prinzen von Troia nicht weiter. Er nimmt sie einfach mit nach Hause. Menelaos ist außer sich und bittet seinen Bruder um Hilfe, den mächtigen Fürsten Agamemnon. Dieser trommelt aus den verschiedenen griechischen Königreichen eine gigantische Armee zusammen und segelt mit ihr über einige Umwege nach Troja, um Helena zurückzufordern. Die Trojaner und ihr König Priamos weigern sich, die Eroberung ihres Prinzen Alexandros herauszurücken und so ist der von Zeus gewollte Krieg endlich entfesselt.
Der Zorn des Achilles
Die Handlung der Ilias beginnt, als im vor der Stadt Troia versammelten griechischen Heer nach vielen Jahren der Belagerung ein Streit zwischen Agamemnon und seinem besten Krieger Achilles ausbricht. In den Siedlungen in der Umgebung von Troja haben die Griechen einige Schätze erobert und auch Frauen entführt und Achilles fühlt sich bei der Verteilung der Beute benachteiligt. Um sich an Agamemnon zu rächen hält er sich und seine Truppe der Myrmidonen aus dem weiteren Kampfgeschehen heraus. Während er verbittert bei den griechischen Schiffen in der Meeresbucht zurückbleibt, tobt in der Ebene vor Troja der Krieg weiter. Sowohl Griechen als auch die Trojaner hoffen längst auf ein Ende des Gemetzels und sind zunächst erleichtert, als sich eine Lösung des Konfliktes andeutet: Weil es schließlich nur um den Raub der Helena geht, fordert ihr Ehemann Menelaos den Prinzen Alexandros zu einem Zweikampf heraus, der den Krieg entscheiden und beenden soll. Alexandros unterliegt in diesem Kampf, aber bevor Menelaos ihn töten kann, wird er von Aphrodite gerettet und vom Kampfplatz entfernt. Die Auflösung des Konfliktes ist damit gescheitert und die Schlacht geht weiter.
Hektor, dem deutlich kriegstüchtigeren Bruder des Alexandros, gelingt es nun, die Griechen bis zu ihren Schiffen zurückzudrängen. Diese versuchen verzweifelt, Achilles wieder in die Schlacht zu involvieren, aber der bleibt stur. Erst als die Trojaner kurz davor sind, die Flotte der Griechen in Brand zu setzen, gibt er seinem Freund Patroklos seine berühmte Rüstung und schickt ihn in die Schlacht. Achilles ist sich sicher, dass sein Freund die Schiffe verteidigen wird, aber dieser wird von Hektor getötet. Als Achilles davon erfährt gerät er endgültig in Rage, stürzt sich wieder in die Schlacht und treibt die Trojaner mit seiner Armee bis in ihre Festung zurück. Vor der Stadtmauer stellt er Hektor in einem Zweikampf, tötet ihn und schleift seinen Leichnam zurück zu den griechischen Schiffen, um ihn dort den aasfressenden Hunden zu überlassen, während er feierlich seinen Freund Patroklos bestattet.
Sowohl die Trojaner als auch die Götter sind darüber erschüttert, dass Achilles den Leichnam Hektors nicht an Troja übergibt, und ihm so eine Bestattung verweigert. Mit göttlicher Hilfe gelingt es Hektors Vater, dem alten König Priamos, unbemerkt in das Lager des Achilles zu schleichen und ihn dort persönlich um die Freigabe des Leichnams zu bitten. Achilles, der bis zu diesem Moment zuerst verbittert geschmollt und dann gnadenlos gewütet hatte, hat Mitleid mit dem König, der durch ihn mehrere Söhne verloren hat, und gewährt ihm Hektors Leichnam und einen Waffenstillstand, um diesen in einer mehrtägigen Zeremonie zu bestatten.
Der Krieg als göttliche Strafe
Die griechische Sage vom Trojanische Krieg hat eine Gemeinsamkeit mit dem in nahöstlichen Kulturkreisen verbreiteten und aus der Bibel oder dem Gilgamesh Epos bekannten Mythos von der Sintflut. So wie die sagenhafte große Flut bezieht sich auch dieser große Krieg möglicherweise auf reale Ereignisse und in beiden Fällen handelt es sich um eine gigantische, unzählige Leben kostende Katastrophe, die von den Göttern als Strafe für die Sitten- und Gottlosigkeit über die Menschen gebracht wurde. Die Götter spielen hier zumindest vorübergehend mit dem Gedanken, die Menschheit vollständig auszulöschen. Es handelt sich also um eine einschneidende Zäsur in der Frühgeschichte der eigenen Kultur, die einen Anfang einer Zeitrechnung rechtfertigen würde und es ist jeweils der letzte Moment in der Geschichte, in dem die Existenz der Menschheit von den Göttern noch einmal in Frage gestellt wird. Hätte Noah beziehungsweise Ut-napishti nicht den Auftrag zum Bau der Arche erhalten und hätte Momos, der Gott des Zweifels, nicht Zeus von seinem ursprünglichen Plan abgebracht, dann hätten diese Katastrophen das Ende der Menschheit bedeutet. Alles Leben nach der Katastrophe muss als eine zweite Chance verstanden werden, die der Himmel den Menschen gewährt. Das Desaster ist die Stunde Null und in ihm liegt die Wurzel aller heutigen Stammbäume. Wer heute lebt, stammt entweder vom Erbauer der Arche ab, oder von den Männern, die im großen Krieg gekämpft haben.
Verständlicherweise ist es für Homer also wichtig, diese Urväter der späteren Griechen angemessen zu würdigen und möglichst niemanden zu vergessen. Daraus erklärt sich vielleicht der sogenannte Schiffskatalog, eine langatmige, detaillierte Auflistung sämtlicher am Krieg beteiligter Völker mit ihren Anführern, ihrer Herkunftsregion und der Stärke ihrer entsandten Flotte. Namentlich erwähnte Hauptakteure des Epos werden typischerweise zusammen mit ihrer regionalen und familiären Herkunft genannt. Es ergibt sich so eine Momentaufnahme der höheren griechischen Gesellschaft zu einem prähistorischen Zeitpunkt, als mancher noch direkt von Göttern abstammte. Homer betont an mehreren Stellen, dass diese Ereignisse aus seiner Sicht bereits weit zurückliegen und die Männer damals noch über andere Kräfte verfügten, zum Beispiel wenn Hektor einen Stein gegen die griechischen Barrikaden schleudert, den ein einzelner Mann heutzutage nicht einmal mehr hochheben könnte. Helden dieses Kalibers kann es laut Homer heute gar nicht mehr geben.
Ganz im Sinne einer von Göttern als Strafe geschaffenen Katastrophe ist dieser Krieg an der Oberfläche betrachtet ohne weiteren Sinn. Der Raub der Helena ist als sein Auslöser längst in den Hintergrund getreten und die blutige Schlacht tobt von den Göttern immer wieder neu befeuert vor sich hin und folgt ihrer eigenen, scheinbar ziellosen Dynamik. Mal haben die Griechen die Oberhand und mal die Trojaner, aber keiner Partei gelingt es, den Krieg für sich zu entscheiden. Grund hierfür ist die Uneinigkeit der Götter, deren Konflikt und Unentschlossenheit sich in den wechselhaften Ereignissen auf dem Schlachtfeld abbildet. Homer selbst ist unparteiisch. Mal nehmen wir an Gesprächen der griechischen Protagonisten teil und ein anderes mal sehen wir Hektor im vertrauten Gespräch mit seiner um ihn besorgten Frau und seinem kleinen Sohn. Dieser Krieg, in dem mal die eine und mal die andere Seite den Vorsprung hat, ist kein Kampf von Gut gegen Böse sondern eine Tragödie, die auf beiden Seiten ihre Helden hervortreten lässt.
Der Plan des Zeus
Hinter dem scheinbar chaotischen Hin und Her zeichnet sich aber doch ein roter Faden ab, nach dem Zeus den Verlauf der Ereignisse von Anfang an geplant hat. Weil die Göttin Thetis den sterblichen Peleus heiraten musste, damit der Krieg überhaupt ausgelöst werden konnte, ist auch ihr Sohn Achilles sterblich. Den Krieg wird er voraussichtlich nicht überleben. Der Tod des Achilles ist zwar erst Gegenstand des dritten Textes der Chronologie, aber Homer greift ihm in der Ilias bereits in mehreren Erwähnungen vor und auch Achilles selbst ahnt sein frühes Ende.
Vor diesem Hintergrund erhält der scheinbar banale Streit mit Agamemnon eine andere Qualität. Unter Tränen fleht Achilles zu seiner Mutter zu Beginn des Epos, er möge doch wenn er schon so früh sterben müsse nicht auch noch um den ihm zustehenden Ruhm betrogen werden. Thetis gibt diese Bitte direkt an Zeus weiter, und dieser sagt ihr zu, dass ihr Sohn die Gelegenheit erhalten werde, seinen Ruhm für die Ewigkeit zu sichern. Der Göttervater unterstützt daraufhin zunächst die Trojaner, baut Hektor zum größten Kämpfer der Schlacht auf und lässt Patroklos sterben, um am Ende Achilles auf Hektor treffen zu lassen. Die Handlung der Ilias wird also einerseits angetrieben durch den Plan des Zeus, Achilles zu größtmöglichem Ruhm zu verhelfen, und es ist gleichzeitig der Plan Homers, an der Figur Achilles einen das gesamte Epos umfassenden Spannungsbogen zu konstruieren, der in einem echten Showdown im Zweikampf zwischen Achilles und Hektor endet.
Hier nutzt Homer alle Tricks, um die Spannung noch auf den Gipfel zu treiben. Erst läuft Achilles von weitem auf Hektor zu, der ihm lange furchterfüllt entgegensieht, um ihm im letzten Moment auszuweichen. Dann jagt Achilles seinen Gegner vier mal um die Stadtmauern von Troja bevor es zur eigentlichen Auseinandersetzung kommt und in dieser will selbst Zeus sich nicht mehr festlegen, zu welchem seiner Helden er halten soll. Er lässt das Los entscheiden und Pallas Athene, die griechische Brünhilde, führt Achilles‘ Hand beim tödlichen Stoß gegen Hektor. Vielleicht ist es eine der Wahrheiten dieser Geschichte, dass bei allen Plänen der Menschen und Götter am Ende der Zufall entscheidet und es auch einen strahlenden Helden wie Hektor erwischen kann.
Die wichtigere Wendung aber vollzieht sich ganz am Ende, wenn Achilles in der Klage des Königs Priamos über Hektors Tod an seinen eigenen Vater denken muss, sich plötzlich mit der trojanischen Königsfamilie identifizieren und zum ersten mal Mitleid empfinden kann. Das ganze Epos ist vom Zorn des Achilles geprägt, zuerst gegen Agamemnon und dann gegen Hektor. Nicht umsonst ist „Zorn“ (menin) das Wort, mit dem der gesamte Text beginnt. Selbst als er Hektor besiegt und der Sterbende ihn anfleht, seinen Eltern wenigstens seine Bestattung zu erlauben und den Leichnam den Trojanern zu überlassen, empfindet Achilles noch nichts als Hass und verneint ihm diesen Wunsch. So erzielt Homer mit dem erst ganz zum Schluss sich in seinem Protagonisten vollziehenden Wandel von Hass in Mitleid einen mitreißenden Effekt und erhebt dieses Mitgefühl zum letzten und eigentlichen Schritt in der Entwicklung des Achilles zum unsterblichen Helden. Nicht im Sieg über Hektor sondern erst in diesem Mitgefühl mit dem Todfeind vollendet sich der Plan des Zeus und Achilles wird durch diesen Beweis charakterlicher Größe der durch das Epos verewigte, versprochene Ruhm zuteil.
Der erste Erzähler
Die erzählerische Leistung Homers wird besonders deutlich, wenn man die Ilias mit dem vierhundert Jahre älteren Gilgamesh-Epos vergleicht. Während die Handlung dort noch eher einer chronologischen Aneinanderreihung von Episoden aus dem Leben des Protagonisten entspricht, weiß Homer ganz genau, wie er zwischen seinen Schauplätzen im Lager der Griechen, der Stadt Troja und dem göttlichen Olymp die Perspektiven wechseln und seine zahlreichen Akteure reden und handeln lassen muss, um seinen Bogen zu spannen und die Handlung ihrem Höhepunkt entgegen zu treiben. Die Ilias ist spürbar näher dran am modernen Erzählen. Die gelungene Auswahl des Zeitfensters im vorgegebenen Sagenstoff und die dynamische Konstruktion der Handlung um die Figur des Achilles sind sicher wesentliche Gründe für den einmaligen Klassiker-Status dieses Werkes. Wie der Protagonist zu Beginn mit einem Konflikt eingeführt wird und dann die Spannung durch seine Abwesenheit und den Aufstieg seines Kontrahenten aufgebaut wird, um sich am Ende in einem Entscheidungskampf zu entladen und in eine überraschende charakterliche Wendung zu münden – das hätten auch moderne Erzähler nicht besser konstruieren können. Dieses Schema hat sich längst vom Kontext gelöst und ist selbst zum Klassiker unter den Plots geworden, der sich in allen möglichen Romanen und Filmen wiederfinden lässt.
Während beispielsweise die Theogonie des Zeitgenossen Hesiod noch deutlich stärkeren religiös-mythischen Charakter hat, ist Homer also vielleicht der erste bedeutende Autor, der die Schwelle zwischen Mythos und Erzählung mit beiden Beinen überschritten hat. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir ausgerechnet über die Person dieses ersten kreativen Erzählers absolut nichts wissen, weil uns so gar nichts anderes übrig bleibt, als sein Werk für sich sprechen zu lassen.
Ilias (in der Übertragung von Raoul Schrott) auf Amazon
und als Hörbuch, gelesen von Rolf Boysen
Ähnliche Beiträge: